Warum verreisen für Menschen mit Behinderung schwierig ist – ein Flugprotokoll
von Karina Sturm.
Was ich am Alleinreisen mit Ehlers-Danlos-Syndrom am schwierigsten finde, ist diese Abhängigkeit von anderen Menschen, die mir durch den Tag helfen sollen. Oft funktioniert das gut, aber manchmal führt es zu mehr Stress und Schmerzen, so wie am letzten Wochenende.
Für ein Herzens- und Studienprojekt flog ich nach London. Eine kurze Strecke mit Direktflügen von Nürnberg aus. Als Frau mit chronischer Krankheit, die von Frührente lebt, gilt natürlich immer, den günstigsten Transport zu finden und oft ist das nicht unbedingt der komfortabelste. Es ist schwierig zu entscheiden, ob man sich finanzielle Probleme erspart und dafür körperliche in Kauf nimmt, oder ob man den besseren Flug bucht und dafür das Bankkonto leert. Ich schätze, das ist der Grund, warum ich verreisen hasse und vorher schon weiß, dass die Anstrengungen schwere Konsequenzen haben werden.
Ich entschied mich für einen Kompromiss. Die Hinreise etwas teurer, aber dafür angenehmer, um nicht den ganzen Aufenthalt lang mit Schmerzen im Bett zu liegen. Die Rückreise dafür mit der Billig-Airline, da ich mich danach zuhause auf dem Sofa wieder erholen könnte. Dumme Idee.
Ich sitze also am Samstag am Stansted Airport. Fünf Stunden vor Abflug. Die Flughafenhalle ist randvoll mit Menschen. Platz ist genug, aber Sitzplätze gibt es kaum in der riesigen Halle. Die Leute sitzen auf dem Boden, auf der Heizung oder auf ihren Koffern. Ich sehe einen Bereich, der als Hilfsbereich für Menschen mit Behinderung gekennzeichnet ist. ”Super”, denke ich mir. Da darf ich sicher sitzen.
Als ich den Bereich betrete, weist mich die Angestellte darauf hin, dass die Sitze nur für Menschen sind, die Assistenz benötigen und rollt mit den Augen. Ich frage mich, ob ich mir das nur einbilde und sie vielleicht genervt ist von der SMS, die gerade auf ihrem Handy erscheint, oder ob das, wie so oft, gegen mich gerichtet war, weil man meine Erkrankung nun mal nicht auf den ersten Blick sieht. Während ich zitternd vor Erschöpfung und bleich von den Schmerzen vor ihr stehe und erkläre, dass ich Assistenz gebucht habe und mich jetzt wirklich hinsetzen muss, weil ich sonst womöglich einfach umkippe, schnappt sie sich desinteressiert meinen Boarding-Pass und sagt zum Glück, dass ich mich setzen darf. Ich fühle mich unwohl, weil ich das Gefühl habe, man glaubt ich würde den Service zum Spass nutzen, obwohl ich ihn nicht brauche.
Ich muss ehrlich zugeben von den Erfahrungen in der Vergangenheit geprägt zu sein. Zu oft habe ich gehört: ”Du siehst doch gar nicht krank aus.” Oder: ”Aber du kannst doch gehen.” Und irgendwann interpretiert man ein Augenrollen als Zweifel an der eigenen Krankheit, obwohl es vielleicht für jemanden anderes bestimmt war. Es ist schwierig diese negativen Gefühle abzustellen und jeder Person eine neue Chance einzuräumen. Trotzdem lässt mich der Gedanke nicht los, dass man mich für eine Betrügerin hält.
Während ich im Wartebereich sitze, werde ich noch zweimal von anderen Angestellten gefragt, ob ich denn wirklich Hilfe zum Flugsteig benötige. Ich antworte mit Ja. Für längere Ausführungen fehlt mir die Energie. Ich warte und warte und warte. Als meine Boardingzeit immer näher rückt, frage ich zweimal nach, ob mich jetzt bitte jemand zum Flugsteig bringen kann, weil ich unbedingt noch vor dem Abflug eine Flasche Wasser kaufen und zur Toilette muss. Die Dame sagt: ”Relax. Das schaffst du leicht.” Mittlerweile ist es 18 Uhr. Mein Flug boardet um 19 Uhr. Ich muss Gepäck aufgeben, durch die Security und zum Gate, das sich laut der Angestellten ca. 25 Minuten hinter der Security befindet. Ich werde nervös, fühle mich gestresst und will einfach nur noch nach Hause. Ich frage mich was wohl passiert, wenn ich den Flug verpasse. Einen anderen Flug an dem Tag gibt es nicht.
45 Minuten vor Boarding werde ich abgeholt. Ein schlanker, großer Herr mit Halbglatze sammelt mich auf und schiebt mich wortlos in Richtung Gepäckabgabe. Wir dürfen an der Schlange, die sich um vier Ecken biegt, vorbei und mein Gepäck ist schnell eingecheckt. Eine ältere Dame, mit blonden, kurzen Haaren, ist die Erste, die mir ins Gesicht schaut und mit mir spricht und nicht mit meinem Begleiter. Sie sagt, dass ich erschöpft aussehe und so als ob ich starke Schmerzen hätte. Sie hat recht. Ich verdränge die Tränen, die in mir aufsteigen, was immer passiert, wenn ich völlig erschöpft bin.
Ich werde zur Security geschoben. Mein Begleiter sagt mir, ich dürfe nur eine Plastiktüte mit Flüssigkeiten haben. Ich erkläre, dass das alles nur Medikamente sind und die daher nicht an ein Limit gebunden sind, weil ich sie nun mal während des Flugs brauche. Er schüttelt den Kopf und reagiert mit einem: ”Na, wenn du das meinst.” Ich erwidere, dass ich für jedes einzelne dieser Medikamente ein Attest in meinem Rucksack habe und dass das in den letzten vier Jahren nie ein Problem war.
Mein Gepäck wird auf drei verschiedene Plastikwannen aufgeteilt und fährt auf dem Band davon, während ich in einer Rollstuhlschlange warte bis jemand sich dazu bewegt fühlt, mich durch die Security zu schieben. Ich erkläre, dass ich durchaus ein paar Schritte gehen, aber nicht lang stehen kann. Ich biete an, durch den Metalldetektor zu laufen, damit es einfacher für alle ist und schneller geht. Wenn es etwas gibt, das ich hasse, dann ist es meine Kamera und meinen Laptop auf der anderen Seite vom Band herauskommen zu sehen, ohne dass ich diese für mich so wertvollen Geräte wieder einpacken kann. Die Security-Dame sagt mir, ich käme halt dran, wenn jemand Zeit hätte den Rollstuhl zu schieben. Mein Begleiter ist mittlerweile verschwunden. Wo er hin ist und was als nächstes passiert, erklärt mir keiner. Generell spricht kaum jemand mit mir.
Irgendwann kommt ein junger Mann auf mich zu und schiebt mich um den Metalldetektor herum. Ich erkläre erneut, dass ich gerne durchlaufen kann. Er erwidert: ”Lehn’ dich zurück und entspann dich.” Die Security-Dame, die mich abtasten soll, wirft genervt ein: ”Ich will nicht schon wieder einen Rollstuhl machen.” Ich schaue sie an und will sagen: ”Ich bin ein Mensch, kein Rollstuhl.” Aber ich schweige. Ich bin zu erschöpft. Eine andere Frau übernimmt die lästige Arbeit und kümmert sich um mich. Sie fragt mich, ob ich irgendwo Schmerzen hätte. Ich muss schmunzeln und erwidere: ”Ja, praktisch überall.” Sie ist sehr vorsichtig mit mir und entschuldigt sich, dass es mir schlecht geht. Ich lächele sie an und bedanke mich, dass sie so bedacht mit mir umgegangen ist. Ich hatte schon andere Erfahrungen.
Die Plastikwanne mit meinen Medikamenten kommt nicht auf meiner Seite des Rollbandes heraus, sondern auf der für zusätzliche Überprüfung. Dort hat sich mittlerweile ein Stau an Handgepäcksstücken gebildet. Mein Flug boardet in 10 Minuten. Der Security fragt, wem die Behältnisse gehören. Mich kann er nicht sehen, da ich hinter unzähligen anderen Menschen sitze. Mein Begleiter erscheint und schiebt mich wortlos in Richtung Band. Die Leute schauen mich alle an, während ich wie Moses das Meer teile und in der Mitte durch die Menschenmenge zum Band geschoben werde.
Der Security-Mann fragt mich, ob ich alleine reise und warum ich so viele Medikamente brauche. Ich erkläre, dass ich diverse chronische Krankheiten habe und dass ich ihm alle Atteste zeigen kann, wenn er mir nicht glaubt. Er nickt, macht einen Sprengstofftest und sagt, die Sachen müssen noch einmal auf das Band. Ich bin etwas ungehalten und erwidere, dass ich in 10 Minuten boarden muss. Er meint: ”Das dauert halt so lange, wie es dauert.” Ich werde immer nervöser und möchte heulen. Ich bin erschöpft von der Reise, habe Schmerzen und will endlich nach Hause.
Fünf Minuten später kommt mein Gepäck erneut aus der Röntgenmaschine und diesmal auf der richtigen Seite. Ich habe keine Zeit zu kontrollieren, ob ich alles habe, weil ich sofort von meinem Begleiter weitergeschoben werde. Ich bin pissed. Als wir zum Gate fahren, frage ich ihn, wem ich denn die Schuld geben darf, wenn ich jetzt meinen Flug verpasse. Er sagt: ”Naja, du kannst sagen die Security sei schuld, aber das interessiert die meistens nicht.” Ich werde etwas ungehalten und erkläre, dass ich seit über fünf Stunden draußen im Rollstuhlbereich gewartet habe und dass ich ewig Zeit gehabt hätte zum Gate zu gelangen und jetzt trotzdem meinen Flug verpassen könnte, nur weil man beschlossen hat mich erst 45 Minuten vor dem Flug aufzusammeln. Ein Zustand den ich nicht kontrollieren konnte und der mich wütend macht. Er sagt, ich helfe gerade nicht. Ich schaue auf eine Tafel an der Wand und sehe neben meinem Flug die Anzeige „Boarding“. Ich frage meine Begleitung, wie weit es noch zum Gate sei, denn mein Flug boardete schon. Er sagt: ”Ca. 10 Minuten.” Ich muss dringend pinkeln, bin dehydriert und fühle mich furchtbar.
Wir kommen näher zum Gate. Eine lange Schlange steht an, aber scheint sich nicht zu bewegen. Er sagt schnippisch: ”Schau, die boarden doch gar nicht. Alles gut.” Für mich ist nichts gut. Ich bin gestresst, wütend und habe das Gefühl, wenn ich einfach gelaufen wäre, hätte ich zwar mehr Schmerzen, aber wäre vermutlich weniger gestresst, als ich es jetzt bin.
Ich werde neben der Schlange kommentarlos abgestellt. Mein Begleiter geht. Ein Airline-Mitarbeiter erklärt mir, dass mich jemand anderes zum Flugzeug bringt, wenn die Schlange geboardet hat. Etwas ironisch werfe ich ein, ob denn wirklich jemand kommt, weil man mich gern ab und an vergisst. „Stimmt schon, ich helfe gerade wirklich nicht“, denke ich mir und zwinge mich zu einem lächeln. Die Leute in der langen Schlange lachen. Ein netter Herr neben mir sagt: ”Wenn die dich vergessen, trage ich dich ins Flugzeug.” Ich bin dankbar. Überraschend viele Menschen, die geduldig anstehen, bieten mir Hilfe an und ich fühle mich etwas besser.
Ruckartig wird mein Rollstuhl bewegt und ich erschrecke ein wenig. Ein junger Mann schiebt mich durch den Nebeneingang weiter in die Nähe des Flugzeugs. Und wieder werde ich wortlos abgestellt. Neben mir ist eine ältere Dame, ebenfalls im Rollstuhl, die mich fragt, wo denn hier die Terrassen sind. Sie möchte eine rauchen. Ihre jüngere Begleitung verdreht die Augen und erklärt ihr, dass es schon seit vielen Jahren keine Raucherterrassen mehr gibt und entschuldigt sich bei mir. Doch die alte Dame weiß was sie will und gibt nicht auf. Erneut wendet sie sich an mich und erzählt mir, dass sie sicher ist, dass es hier eine Raucherterrasse gibt und ob ich sie da nicht hinbringen kann. Ihre Begleitung entschuldigt sich erneut bei mir. Ich hingegen finde das Gespräch recht amüsant und erkläre der älteren Dame, dass die Flughäfen mittlerweile nur noch selten Raucherbereiche haben, aber dass ich schon verstehen kann, dass sie da jetzt Lust drauf hätte. Das stimmt sie zufrieden und ich bilde mir ein sie hätte ihrer Begleitung einen ”Siehste, die versteht mich”- Blick zugeworfen.
Eine zierliche, kleine Frau mit blonden Haaren nähert sich mir und fragt, ob ich einen Lift in das Flugzeug benötige. Ich merke zum gefühlten hundertsten Mal an, dass ich durchaus etwas gehen kann, dass ich nur gerade recht schwach bin und nicht lang auf einer Stelle stehen kann. Sie ist verständnisvoll und freundlich und erklärt mir jedesmal, wenn sie anfängt meinen Rollstuhl zu bewegen, was gerade passiert. Das mag ich. Sie behandelt mich wie einen Menschen. Sie bringt mich bis vor die Stufen zum Flugzeug und trägt mir meinen Rucksack sogar über die Treppen hinauf. Ich kann ihr ansehen, dass sie ehrlich besorgt ist, denn sie bleibt ganz nah hinter mir und sieht aus, als wäre sie bereit mich aufzufangen, sollte ich fallen. Ich frage mich, wie viel angenehmer meine bisherige Reise wohl gewesen wäre, wenn ich diese Person die ganze Zeit bei mir gehabt hätte.
Im Flugzeug falle ich in meinen Sitz und schließe meine Augen, als ein Passagier strauchelt seinen Koffer im Fach über mir zu verstauen. Reflexartig halte ich meine Arme nach oben und plopp fällt mir ein Koffer auf die ausgestreckten Arme. „Besser als auf den Kopf“, denke ich mir und hinterfrage meine Strategie immer einen Randplatz zu buchen, um meine Beine auf den Gang strecken zu können. Ich warte geduldig bis alle Passagiere sitzen. In dem Moment in dem die Tür schließt, fallen mir die Augen zu und ich wache erst in Nürnberg wieder auf. Uff, was für ein Tag.
Ich nutze nur selten einen Rollstuhl und jedesmal, wenn ich das tue, fühle ich mich komisch. Nicht wegen des Rollstuhls – der ist ein nützliches Hilfsmittel. Ich fühle mich komisch, wegen der Mitmenschen, die mich plötzlich nicht mehr wie eine Person behandeln, sobald ich darin sitze. Mit den mitleidsvollen Blicken habe ich kein Problem. Ganz ehrlich, manchmal glaube ich, sehe ich aus, als müsste man mit mir leiden. Was mich aber belastet ist, dass manche Leute einen behandeln, als wäre man ein Gegenstand. Man wird nicht mehr als Person angesprochen, nein, man ist ”der Rollstuhl”. Und ich hasse das Gefühl abhängig zu sein vom Wohlwollen meines Umfelds. Keine Kontrolle mehr darüber zu haben, wann man mich zum Gate bringt, weil ein gebuchter Rollstuhl gleichzeitig heißt, zu warten bis andere es für nötig halten, dass ich mich bewege. Ich darf nicht mehr selbst entscheiden, wann ich wo hin will und auf dem ganzen Weg zum Gate, entscheiden andere Menschen, ob und wann ich mich fortbewege. Es gab unzählige Momente, in denen ich gerne einfach aufgestanden und gegangen wäre – ganz egal, was die negativen Folgen gewesen wären. Ständig einfach angeschoben zu werden, ohne ein Wort oder eine Erklärung, was gerade passiert, hat mir das Gefühl gegeben, dass, obwohl meine Einschränkung nun sichtbar war, ich hingegen als Mensch, plötzlich unsichtbar wurde. Ich war ein Ding. Ein Rollstuhl. Und für viele der Menschen, die eigentlich Hilfestellung geben sollten, war ich eine Belastung, was dazu führte, dass ich wirklich keine Lust mehr habe, nochmal alleine zu verreisen. Und das sollte so nicht sein.
Menschen mit Behinderungen oder Krankheiten sollten genauso viel Spaß am Reisen haben dürfen, wie ihr gesundes Umfeld. Und ein respektvoller Umgang mit Menschen mit Behinderung sollte keine Ausnahme sein, sondern die Regel.
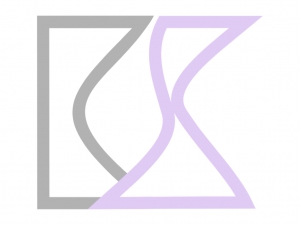
 Karina Sturm
Karina Sturm
 Karina Sturm
Karina Sturm 


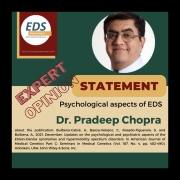
 Karina Sturm
Karina Sturm  Christopher Freitag
Christopher Freitag 
 DisAbility Talent
DisAbility Talent
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!