Warum ich als chronisch Kranke nichts von Optimismus halte
von Karina Sturm.
Geht es euch ab und an so, dass euch jemand fragt, warum ihr „negativ“ seid und euch erzählt, vielleicht würde es euch besser gehen, wenn ihr etwas optimistischer sein könntet?
Lasst uns etwas über Optimismus sprechen.
Ein Beispiel von vor zwei Tagen:
Nach einem unglaublich schönen Tag in Aachen, wo ich bereits die ganze Woche mit Arztterminen verbrachte, fühlte ich mich richtig lebendig, hoffnungsvoll und gut.
Ich hatte das Gefühl nach einer langen ziemlich üblen Phase geht es endlich wieder bergauf. Denn obwohl immer wieder Täler kommen, traue ich mich nach einer längeren guten Phase wieder zu hoffen, dass diese anhält. Das passiert automatisch.
Ich sitze also mit einem Lächeln im Gesicht auf meinem Sessel und freue mich darüber, dass ich es nicht nur geschafft habe, alle meine Arzttermine und Untersuchungen unbeschadet zu überstehen, sondern dass es mir sogar gelungen ist, den diesjährigen Ärztetrip mit einer schönen Erinnerung zu verbinden. Nämlich der, dass ich selbständig, ganz alleine und ohne fremde Hilfe irgendwie geschafft habe hier klarzukommen, für eine ganze Woche. Ich konnte mich sogar noch mit Bekannten treffen ohne dass es mich völlig zerlegt hätte.
Das war ein Fortschritt, zumindest ein kleiner.
Als ich von unserem Treffen zurück in mein Gästezimmer kam, war ich einfach nur zufrieden. Eine Zufriedenheit, die ich in der Form schon lange nicht mehr hatte. Ich war glücklich mit mir selbst – ganz alleine, konnte seit langem ehrlich sein und musste kein Lächeln vorspielen, denn ich meinte es ernst. Und ich hoffte dieser Tag würde nie zu Ende gehen.
Natürlich wollte ich dieses Glück in meinem Buch festhalten und schrieb ein langes Kapitel darüber, wie ich vielleicht wirklich neue Pläne für meine Zukunft schmieden könnte und wie gerade alles gut war. Es gab für einen kurzen Moment keine Probleme.
Nach diesem trotzdem sehr anstrengenden Tag legte ich mich ins Bett und dachte ich könnte ihn mit einem guten Film ausklingen lassen.
Zwei Stunden später vibrierte mein Handy – eine lang erwartete Email eines Neurochirurgens, den ich vor kurzem in San Francisco kennenlernte.
Und klirr – Fünf Minuten später war das ganze Glück dahin und Verzweiflung ersetzte dieses Gefühl.
Nicht wie vorher besprochen, bot er eine OP an, nein viel mehr hatten sich seine Kollegen anhand meines Alters (nicht meiner Bilder oder Befunde) gegen eine OP entschieden. Ich hatte all meine Hoffnungen in diesen Arzt gesetzt, da er bis zu dieser Email komplett hinter mir stand. Und von einer Minute auf die andere wars dahin – das Gefühl selbständig sein zu können, sicher zu sein, Lösungen gefunden zu haben und auch das Glück.
Wie immer wenn mich ein solcher Schlag trifft, bricht erstmal ein Stückchen in mir selbst zusammen.
Ich habe diese Art Nachricht einfach schon zu oft bekommen und mit jedem Mal wird es nur schlimmer. Man würde meinen, man gewöhne sich daran, aber es ist eher das Gegenteil. Mit jeder Absage und vor allem mit jedem Vertrauensbruch wird man skeptischer, pessimistischer.
Und manchmal fühlt es sich an wie verhext. Ich könnte schwören, dass ich immer dann, wenn ich laut ausspreche, dass ich mich gerade ganz wohl fühle, ein paar Stunden später eine vor den Kopf geknallt bekomme. Weshalb ich mir auch häufig verkneife wieder zu hoffen, es könnte doch noch besser werden, weil der Fall einfach zu heftig ist. Es ist das furchtbarste Gefühl, wenn eine Hoffnung zerstört wird und man wieder in ein Loch fällt.
Gar nicht zu hoffen verhindert zumindest diesen schweren Aufprall.
Aber natürlich kann man auch nicht sein ganzes Leben auf Rückschläge warten. Ich fange automatisch wieder zu hoffen an, obwohl ich schon im Hinterkopf habe, was wohl nun als nächstes kommen könnte, welche Baustellen denn noch offen sind und mich mal eben erschlagen könnten.
Warum bin ich nun nicht optimistischer?
Vermutlich deshalb, weil ich sonst komplett kaputt gehen würde. Ich bin lieber neutral eingestellt und freue mich dann über positive Nachrichten, als ständig wieder in ein Loch fallen zu müssen. Es ist meiner Meinung nach nicht richtig, wenn einem gesagt wird, mit einer optimistischen Einstellung würde es einem besser gehen. Ganz im Gegenteil, ich würde mental sehr viel schlechter klar kommen, denn realistisch betrachtet lebe ich mit einer Erkrankung die selten besser wird. Deshalb bin ich glücklich darüber, wenn sie zumindest konstant bleibt und nicht weiter schlechter wird. Mir hilft es mich mit möglichen Verschlechterungen auseinanderzusetzen, um mich dann, sollte der Zustand eintreten, nicht völlig hilflos und überfordert zu fühlen. Das heißt für mich, mich auch damit auseinanderzusetzen, was ich denn noch aus meinem Leben machen kann, sollte ich jemals einen Rollstuhl benötigen.
Realist zu sein bedeutet für mich ein Stück Kontrolle über meine Situation zu haben.
Und nicht bei jedem neuen Symptom, bei jeder Verschlechterung völlig einzugehen. Realistisch sein heißt zu wissen, was auf mich zukommen kann, aber nicht muss. Es bedeutet einschätzen zu können, wie meine gesundheitliche Zukunft aussehen könnte.
Optimist zu sein wäre für mich nicht nur wenig hilfreich, sondern sogar gefährlich, weil es mir ein Leben vorgaukeln würde, das ich nicht erreichen kann, was im Gegenschluss heißen würde, ich wäre mit meinem jetzigen Leben nur noch unglücklich.
Optimismus ist nichts was ich mir erlauben kann. Und das hat etwas mit Erfahrungen zu tun und nicht mit Wunschträumen.
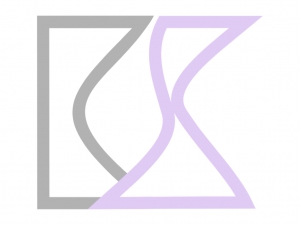
 Karina Sturm
Karina Sturm 



 Karina Sturm
Karina Sturm 



 Karina Sturm
Karina Sturm  Denise
Denise
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!