10 Situationen, die bei chronisch Kranken Angst auslösen
von Karina Sturm.
In diesem Blogpost möchte ich über Angst sprechen. Ein Thema, das bei chronisch Kranken so präsent ist, aber das selten thematisiert wird.
Um euch näherzubringen mit welchen Ängsten ich zu tun habe, führe ich euch durch eine bestimmte Situation in der Vergangenheit: Der Anfang der Angst und des Ehlers-Danlos-Syndroms.
1. Angst vor dauerhaften Symptomen.
Ich sitze auf meinem braunen, schlecht gepolsterten Sofa in Rattanoptik in meinem großen Wohnzimmer in Erlangen. Durch die deckenhohe Glasfront dringen die letzten Sonnenstrahlen des Tages. Ich fühle mich etwas komisch. Am Tag zuvor hatte ich Spritzen in die Halswirbelsäule bekommen und seither ist mir nicht ganz wohl. Ich schaue auf die Fotowand hinter mir und frage mich, ob ich wohl jemals zu so einem traumhaften Strand fliegen würde. Auf der Tapete ist eine Palme und das Meer zu sehen. Sie erstreckt sich über die ganze Höhe des Raums und gibt mir ein Urlaubsgefühl, wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme. Mein damaliger Freund hat mir Nudelauflauf gekocht. Den mag ich besonders gern. Es soll das letzte Mal sein, dass ich ihn esse. Während ich die erste Gabel mit geringelten Nudeln mit Schinken und Sahnesoße in den Mund nehme, wird mir plötzlich schwarz vor Augen. Ich erschrecke. Was passiert da gerade? Ich will aufstehen, mich bewegen. Meine Beine knicken weg. Ich spüre sie nicht mehr richtig. Als ich gerade noch auf meine Füße starre und zurück aufs Sofa sacke, sind auch meine Arme taub und ich merke, wie meine halbe Gesichtshälfte aus meiner Wahrnehmung verschwindet. Ich denke ich habe einen Schlaganfall und Angst gelähmt zu sein. Das ist der erste Moment, der mich mit wirklicher Angst konfrontiert.
2. Angst vor einer Fehldiagnose.
Ich rufe einen Arzt. Der sagt mir, ich hätte einen niedrigen Blutdruck, vielleicht eine Panikattacke. Ich erkläre ihm, dass ich noch nie Angst hatte, aber aufgrund der Situation im Moment schon etwas besorgt sei. Die Untertreibung des Jahres. Er lächelt mich an, löst eine Frage bei „Wer wird Millionär“, was die ganze Zeit nebenbei im Fernsehen läuft und sagt, das würde schon wieder werden. Dann geht er. Ich habe Angst, dass er nicht richtig liegt.
3. Angst vor dem Sterben.
Die folgenden Nächte sind ein Albtraum, aus dem ich nicht aufwachen darf. Ich liege in meinem französischen Bett mit roter, samtener Bettwäsche, auf denen das chinesische Zeichen für Liebe steht. Als verkappte Romantikerin hatte ich beim Einzug einen Schriftzug bestehend aus drei chinesischen Zeichen in der Mitte des Raums an die Wand gemalt, der hoffentlich auch so etwas wie „Ich liebe dich“ heißen sollte. Weil ich nie gut in Kunst war, sehen die Zeichen unförmig aus. In dem Raum fühlte ich mich immer wohl. Bis heute. Mein Körper stellt die unbewusste Atmung ein. Ich wache immer dann, wenn ich einschlafe sofort reflexartig auf – als hätte mein Körper aufgehört zu atmen. Wenn ich wach bin, muss ich mich bewusst daran erinnern einzuatmen. Ich fühle mich, als würde ich sterben und zum ersten Mal habe ich Angst vor dem Tod, über den ich mir vorher nie Gedanken gemacht hatte.
4. Angst davor, dass man mich hilflos zurücklässt.
Die Tage und Wochen danach verbringe ich in allen erdenklichen Arztpraxen. Eine davon ist eine Praxis für Neurologie, in der ich drei Stunden nach Luft ringend im Wartezimmer verbringe. Der Arzt macht ein EEG, sieht abnormale Wellen, aber schlussfolgert, das diese in meinem Fall nicht von Bedeutung sind und schickt mich zum Psychologen. Das hilft nicht. Ich kann immer noch nicht atmen. Wochen später werde ich in die Notaufname eingewiesen. Man vermutet einen Riss meines gehirnversorgenden Gefäßes. Zum ersten Mal werde ich in eine Röhre geschoben. Bis heute sollen unzählige MRTs, CTs, Röntgenaufnahmen usw. folgen. Als ich zurück auf mein Zimmer komme, stürmen Ärzte herein und schieben mich in die Stroke Unit, die Schlaganfallstation. Man vermutet, dass beide Arterien, die zu meinem Gehirn führen, gerissen seien. Ich liege mit zwei älteren Menschen in einem Zimmer ohne Toilette. Alle anderen Räume sind voll besetzt und jeder schnarcht, aber schlafen kann ich ohnehin nicht, weil ich an einem Tropf mit Heparin hänge, jede Stunde Blut genommen wird, und mein Blutdruck und die Sauerstoffsättigung regelmäßig überprüft werden. Im Zimmer nebenan randaliert ein verwirrter Herr und wirft Gegenstände durch den Raum. Ich bin verunsichert und niemand erklärt mir, was diese Diagnose für mich bedeutet. Am nächsten Morgen kommt eine Horde junger Ärzte in den Raum, stellt sich um mein Bett herum und erklärt mir, dass ich nun entlassen würde, es wäre doch kein doppelter Gefäßriss. Alles sei gut. Nichts ist gut. Wieso hilft mir denn keiner? Ich fühle mich mehr Tod als lebendig und es schien niemanden zu interessieren. Zum ersten Mal hatte ich Angst, dass man mich einfach sterben lässt ohne dass ein Arzt etwas unternehmen würde.
5. Die Angst alles zu verlieren: Kontrolle über mein Leben, Freunde, Job, finanzielle Unabhängigkeit.
Auch die Monate danach interessiert sich kein Mediziner für meine Symptome. Ich bin mehr krank geschrieben als in der Arbeit und fürchte um meinen Job. Flüchtige Freunde wenden sich ab, weil ich nichts mehr mit ihnen unternehmen kann. Ich kann auch nicht mehr Volleyball spielen, was mein wichtigstes Hobby war. Angst macht sich breit. Wie soll das nur weitergehen? Ich verstehe nicht, was mit meinem Körper passiert und nichts in meinem Leben kann ich noch steuern. Die Angst davor, einfach alles zu verlieren, was mir jemals wichtig war, ist riesig.
6. Die Angst von Ärzten nicht ernst genommen zu werden.
Alle Termine verlaufen im Nichts. Wenn ich meine neurologischen Beschwerden aufliste, belächeln mich die Ärzte und schicken mich nach fünf Minuten nach Hause. Von niedrigem Blutdruck über unzählige psychische Fehldiagnosen ist alles dabei. Ich höre Sätze wie: „Das ist alles in deinem Kopf; Du bildest dir das nur ein.“ Und der Favorit: „Du hast zu viel Stress.“ Immer wenn ich erkläre, dass das nicht stimmt, werde ich nur noch mehr belächelt. Irgendwann gebe ich auf. Ich will nicht mehr zu Ärzten gehen. Niemand glaubt mir und bei jedem weiteren Termin sitze ich nervös im Wartezimmer und habe Angst wieder nicht ernst genommen zu werden. Ich verliere jegliches Vertrauen in die Menschen, von denen ich früher dachte, dass sie da sind, um zu helfen. Ich habe Angst vor Ärzten und bin schweißgebadet vor jedem Termin.
7. Die Angst vor der korrekten Diagnose; die Angst davor, nie eine zu bekommen.
Nach vier Jahren stehe ich kurz vor der Diagnose Ehlers-Danlos-Syndrom, die mehr oder minder durch Zufall fällt. Die Zeit zuvor verbringe ich mit viel eigener Recherche und komme dem Thema recht nah. Während ich mich durch alle erdenklichen Symptome und passenden Krankheiten google, begleitet mich die Angst. Die Angst, ein Leben lang mit ungeklärten Symptomen zu leben, weiterhin der Hilflosigkeit ausgeliefert ohne einen einzigen Arzt zu haben, der mir glaubt. Aber auf der anderen Seite, die Angst vor einer chronischen Krankheit. Davor, nie mehr gesund werden zu können. Davor, ein Leben lang mit einer Krankheit leben zu müssen, ohne zu wissen, wie es weitergeht.
8. Die Angst vor der Zukunft.
Als ich endlich mit EDS diagnostiziert werde, ist die Erleichterung groß. Aber gleichzeitig gesellt sich eine diffuse Angst dazu, wie meine Zukunft wohl aussehen wird. Auf einmal bin ich chronisch Krank und über die nächsten Jahre sollen noch ein paar zusätzliche Diagnosen hinzukommen. Irgendwann stumpfe ich ab, lerne damit zu leben und die Krankheiten zu akzeptieren. Doch im Hinterkopf bleibt immer ein klein bisschen Angst davor, was passiert, wenn die Krankheit weiter fortschreitet und wie man dann mit neuen Einschränkungen umgehen kann.
9. Die Angst vor Komplikationen.
Mit der Diagnose kommen neue Probleme, neue Dinge auf die man achten muss und gerade bei seltenen Erkrankungen muss man ständig damit rechnen, vor einem Arzt zu stehen, der nicht weiß, was es bei diesen Erkrankungen zu beachten gibt. Einerseits stehen unzählige Untersuchungen an, andererseits sind diese oft mit möglichen Komplikationen verbunden und plötzlich ist man ein Risikopatient. Vor jedem Test steht die Angst, das etwas schief geht und man am Ende kränker ist als zuvor.
10. Die Angst, die Angst zuzugeben.
Und an letzter Stelle steht die Angst, die Angst zuzugeben. Warum? Weil viele Mediziner in Deutschland ganz besonders gern psychische Krankheiten diagnostizieren und wenn man diesen Stempel einmal hat, wird kaum noch nach körperlichen Ursachen für neue Symptome gesucht. Das hat zur Folge, das man aus der Angst heraus, wieder nicht ernst genommen zu werden, gar nicht über Ängste spricht, die praktisch immer eine Konsequenz der vielen kleinen Traumata der Jahre voller chronischer Krankheit sind. Als natürliche Reaktion auf die Fehlbehandlungen und -diagnosen, Hilflosigkeit und die Verletzungen unser Würde entsteht Angst und diese zuzugeben, führt vielleicht zu mehr falschen Behandlungen. Also schweigt man, lernt selbst damit umzugehen.
Diese Situation finde ich besonders belastend, denn psychische Krankheiten sind ohnehin immer noch stigmatisierend und irgendwie trägt unser Gesundheitssystem dazu bei, dass man als Mensch mit chronisch körperlicher Erkrankung eine absolute Abneigung gegen solche F-Diagnosen entwickelt. Nicht weil ich psychische Krankheiten herunterspielen möchte – ganz im Gegenteil, ich kenne viele Menschen mit psychischen Krankheiten und weiß, was für Kämpfe diese austragen müssen – aber, weil man als körperlich Kranker mit psychischer Diagnose nur noch mehr Schwierigkeiten hat, ernst genommen zu werden.
Über die Jahre als chronisch Kranke habe ich mir viele Strategien zurecht gelegt, um gut mit meinen Ängsten umgehen zu können, ohne dafür eine professionelle Behandlung zu brauchen. Ich glaube viele von uns sind Meister im Coping und jeder muss seinen eigenen Weg finden, gesunde Mechanismen zu entwickeln, um mit den Ängsten zu leben.
Vieles von dem, was uns als chronisch Kranken Angst macht, wäre einfach zu verhindern. Würden Ärzte unserem Körpergefühl mehr vertrauen und uns als Patienten als gleichgestellt betrachten, dann wären wir weniger Traumata ausgesetzt und unsere Angstlevel würden sich deutlich reduzieren. Doch bis das geschieht – falls es überhaupt jemals passiert – müssen wir wohl selbst lernen mit der Angst umzugehen.
Und wie ich das mache, erzähle ich euch demnächst.
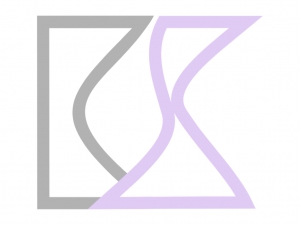
 Karina Sturm
Karina Sturm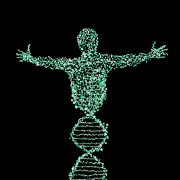
 Pexels - Pixabay
Pexels - Pixabay





 Wiebke Klein
Wiebke Klein
Ich habe Angst davor im Notfall nicht zu wissen an wen ich mich wenden kann. Wenn es mal dringend ist, wenn es mal schnell gehen muss. Wenn die Öffnungszeiten nicht mit meinen Problemen übereinstimmen. Und wie komme ich dort hin, wenn ich selbst grad nicht fahren kann?! Die langen Wartezeiten und drohende Ergebnislosigkeit lassen mich das ein oder andere mal auf dringendes Hilfeersuchen verzichten.
Nein, ich gehe nicht in eine Notaufnahme oder hole den Rettungswagen, weil das zuständige Krankenhaus in meiner Stadt mir noch nie geholfen hat. Im Gegenteil.
Außerdem sind die MitarbeiterInnen dort schon deshalb nicht sehr hilfreich, weil zu viele Leute mit aus Ihrer Sicht Nichtigkeiten dort alles überfüllen.
Das war zwar schon Thema in der Zeitung und es soll mit Notdienstpraxen Abhilfe geschaffen werden, aber trotzdem kann es vorkommen, dass man z.B. als Maler mit einer Vergiftung stundenlang warten muss, sich ständig übergibt und dann als Alkoholfall falsch abgestempelt einfach nicht weiter beachtet wird. Nur eines von vielen Beispielen.
Die größte Angst bei mir ist keine oder die falsche Hilfe zu bekommen und dann nicht mehr weiter zu wissen.
Wie ich damit umgehe? Resignieren und dann doch wieder hingehen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und selbst aufpassen, recherchieren, nachfragen, selber Diagnosen vorschlagen, auch wenn das absolut nicht gern gesehen wird. Weitermachen.
Hallo liebe Sandra,
du sprichst da ein sehr wichtiges Thema an, das ich nur zu gut kenne. Ich habe ebenfalls solche Erfahrungen gemacht. Wozu in die Notaufnahme, wenn man danach mit einer Fehldiagnose entlassen wird und das Grundproblem, wegen dem man dort war, ohnehin nicht beachtet wurde. Viele Ehlers-Danlos-Patienten haben keine Ansprechpartner im Falle eines Notfalls. Oder die Ansprechpartner sind am anderen Ende Deutschlands und da kann man bei akuten Problemen auch nicht hin.
Ich handhabe das mittlerweile so dass ich mich bei den meisten akuten, neuen Symptomen fragen: Sind die lebensbedrohlich? Wenn ja, dann führt kein Weg an der lokalen Notaufnahme vorbei. Meistens sind meine Symptome aber nicht lebensbedrohlich sondern nur sehr lebenseinschränkend. Und dann findet man, wie du schon sagst, eben selbst Wege damit umzugehen. Ich habe auch für Notfälle Dokumente zusammengestellt, die kurz und übersichtlich meine Diagnosen auflisten und klare Anweisung geben, welche Medikamente z. B. vertragen werden und welche nicht. Das gibt mir zumindest ein wenig Sicherheit. Ob sich daran gehalten wird, weiß ich natürlich nicht.
Es ist traurig wie allein gelassen man wird und diese Hilflosigkeit kann einen auch schon mal stark verzweifeln oder wütend machen. Ich muss dann auch immer aufpassen, dass ich neue Ärzte nicht spüren lasse, welche schlechten Erfahrungen ich bereits gemacht habe. Denn manchmal ist ein toller Arzt dabei, der wirklich helfen will.
Aber am Ende müssen wir Patienten uns doch oft einfach selbst helfen und werden zu unseren eigenen Medizinern. Halt die Ohren steif!
Karina
Liebe Karina,
Danke für Deine wichtigen Worte. Hier kommt ein Update: ich bin nach wie vor froh, dass Du die Situation von chronisch und auch unsichtbar Erkrankten so gut auf den Punkt bringst.
Ich habe auch einfach immer weiter gemacht. Nicht aufgeben! Das ist wirklich wichtig. Und nun ist es durch Zufall dazu gekommen, dass ich nach weit über 30 Jahren Suche mit 46 Jahren endlich meiner Erkrankung einen Namen geben kann. Es ist zwar noch nicht offiziell, aber ich erlaube mir jetzt sagen zu können, dass ich am Visual Snow Syndrom erkrankt bin.
Seit dem befinde ich mich in einem Happy Sad Zustand. Happy, weil meine Leiden endlich fassbar geworden sind, ich bin gar nicht psychosomatisch erkrankt, ich hatte Recht, all die vielen Jahre! Sad, weil die Krankheit noch nicht gut erforscht ist und es bisher keine Heilung gibt.
Aber ich bleibe zuversichtlich und bin gespannt darauf, ob sich wenigstens der Umgang mit mir und meinen gesundheitlichen Einschränkungen verbessern lässt, jetzt wo das Kind einen Namen hat. Wenn sich auch meine Erkrankung nicht verbessern lässt, dann kann ich wenigstens mit Würde weitermachen. Es ist besser mit einer positiven Grundstimmung krank zu sein, als mit einer negativen, verzweifelten.
Ich wünsche allen die es brauchen so viel Glück bei der Suche nach einer Diagnose. Natürlich ist das nicht einfach und Erfolg nicht Garantiert, aber wer nicht kämpft hat schon verloren. Seltene Erkrankungen sind zwar eben selten, aber vorhanden.
Machen wir das Beste draus!
Herzliche Grüße von Sandra
Hi Sandra. Es freut mich zu hören, dass du endlich eine Diagnose hast! Das ist der erste Schritt, um Therapien zu finden. In meinem Fall war es aber vor allem der erste Schritt, ein neues Leben anzufangen und die Erkrankung zu akzeptieren. Ich drücke dir die Daumen, dass du eine passende Therapie findest! Liebe Grüße, Karina
Es ist 2 Uhr nachts und ich lese deinen Artikel über Ängste, da ich gerade nicht weiß, wie es weitergeht und wie es wohl aussehen wird, wenn ich mit EDS alt werde.
Jetzt geht es mir besser. Vielen Dank für all deine Mühe und deine Arbeit.
Freut mich, dass es dir besser geht. Melde dich gerne, wenn du was brauchst. Gruß