Mein chronisch krankes Leben – Deutschland versus USA
von Karina Sturm.
Wie unterscheidet sich mein Leben in den USA von dem in Deutschland?
Und geht es mir medizinisch gesehen nun besser?
Das haben mich einige meiner Leser*innen gefragt.
Die kurze Antwort darauf ist: Chronisch krank sein ist immer mies – überall auf der Welt. Es spielt keine Rolle ob ich mit EDS in San Francisco oder in Neumarkt wohne, doch natürlich gibt es Unterschiede in der medizinischen Versorgung und auch Umwelteinflüsse spielen eine Rolle auf das Wohlbefinden und die Lebensqualität eines chronisch kranken Menschen.
In Deutschland war ich nach zwei Jahren Suche ärztetechnisch ganz gut versorgt. Ich hatte Spezialisten für fast jede meiner Erkrankungen, ausgenommen der HWS-Instabilität, welche immer noch auf einem anderen Blatt steht. Ich wusste, wenn ich diesen Schritt ins Ausland wage, müsste ich ganz von vorne anfangen und mir ein neues Team an Ärzten aufbauen und das würde schwierig werden. Trotzdem war ich froh zu wissen, dass die USA, was Forschung an meinen Krankheitsbildern angeht, weit voraus ist. Häufig wird das in Deutschland als Kritik am Land oder der Medizin dort angesehen, obwohl das eigentlich nicht der Fall ist. Der Fortschritt der USA lässt sich einfach erklären, denn dieses Land ist schon flächenmäßig viel größer als Deutschland und hat dementsprechend eine höhere Dichte an Forschungseinrichtungen, die zum Teil auch ganz schön prestigeträchtig sind, wie die National Institutes of Health zum Beispiel. Außerdem fließt relativ viel Geld in die Forschung von seltenen Erkrankungen, was EDS-Betroffenen auf der ganzen Welt zu Gute kommt. Es gibt keine Grenze wenn es um Wissenschaft geht – wenn dann nur in den Köpfen einzelner Menschen. Forschungsergebnisse, egal aus welchem Land, können überall auf der Welt abgerufen und gelesen werden. Weshalb es für mich ein Rätsel ist, warum es wichtig ist woher die Ergebnisse kommen. Ist es denn nicht viel wichtiger dass es diese gibt? Es besteht ein fast grenzenloser Zugang zu allen erdenklichen Ergebnissen, seien diese aus Asien, Europa oder den USA. Sämtliche EDS-Publikationen sind auch deutschen Ärzten zugänglich, warum diese oft nicht gelesen oder nicht anerkannt werden, habe ich bislang nicht verstanden.
Spezialisten für EDS gibt es in den USA einige. Für jeden Bereich in Bezug auf EDS und dessen Komorbiditäten lassen sich gleich mehrere Koryphäen benennen, welche einfach über deren unzählige Publikationen zu identifizieren sind. Der Haken bei der Sache ist allerdings, dass diese Spezialisten sich zu einem Großteil an der Ostküste des Landes befinden oder über diverse Staaten verteilt sind. Kein Patient hat Zugang zu allen Ärzten die er bräuchte, manche sogar zu keinem. Ironischerweise habe ich von San Francisco aus genauso wenig Möglichkeiten zu meinen Chirurgen zu gelangen, wie von Deutschland aus. Das war mir vorher bekannt – ich hatte mich in Online-Gruppen dazu informiert und festgestellt, dass diese Seite des Landes in Bezug auf EDS-Spezialisten recht schlecht aussieht. Da ich Deutschland aber nicht verlassen habe, um in den USA bessere medizinische Versorgung zu genießen, sondern weil ich endlich mit meinem Mann zusammenleben wollte, muss ich diesen Preis bezahlen. Ausschlaggebend für die Entscheidung zu Auswanderung war dass sich meine medizinische Versorgung nicht verschlechtern durfte. Sie bleibt tatsächlich unverändert. Als Rentnerin werde ich außerdem nie wieder viel zu unserem Einkommen beitragen können, weshalb für mich schnell klar war, dass ich die Person die für unser Überleben sorgt, grenzenlos unterstütze, soweit meine Gesundheit dies zulässt. Das war der Deal. Mit allen anderen Problemen kann und muss ich in den USA eben umgehen wie in Deutschland auch. Dieses „unverändert“ geht sogar so weit, dass selbst die Entfernung zu meinen Chirurgen ähnlich weit ist und der Flug nur unwesentlich kürzer. Auch die Kosten trage ich weiterhin selbst, denn genau wie in Deutschland decken die Versicherungen in den USA natürlich nicht das komplette Land ab (da würden sie arm werden) sondern nur den Staat in dem man lebt, und auch da gibt es weitere Einschränkungen.
Insgesamt funktioniert das Gesundheitssystem in den USA anders als in Deutschland, was mich vor die größte Hürde stellte. Ich wusste, meine medizinische Versorgung ist der Knackpunkt und der teuerste Posten auf einer langen Liste Pro und Kontra Auswanderung. Glücklicherweise bin ich dank dem Arbeitgeber meines Mannes in einer guten Versicherung, die von Ärzten in Kalifornien meist akzeptiert wird. Das war für mich ganz wichtig, sonst hätten wir die Auswanderung nicht realisieren können. Eine große Wahl hatten wir aber nicht. Es war entweder die Versicherung des Arbeitgebers oder keine, denn alleine die monatlichen Krankenversicherungskosten hätten mehr gekostet als ich monatlich zur Verfügung hatte. Wir sind nun in einem sogenannten PPO-Plan versichert, was bedeutet, dass ich mir selbst aussuchen darf zu welchen Ärzten ich gehe. Das ist wichtig, denn wie wir alle wissen, Ärzte für EDS sind rar, auch in einer Stadt wie San Francisco. Gerade davor mir ein neues Team an Ärzten aufzubauen hatte ich große Angst. In dem Moment in dem ich in Deutschland relativ gut versorgt war, stehe ich in einer neuen Stadt wieder ganz am Anfang. Überraschenderweise fand ich schnell ein paar kompetente Leute, darunter eine Physiotherapeutin, die mich in meiner neuen Heimat unterstützen. EDS ist hier kein Fremdwort. Größere Stadt – mehr Optionen. Neurochirurgen – Fehlanzeige. Die sitzen an der Ostküste, während ich mich in San Francisco durch Frustration und Angst kämpfe. Ein klarer Unterschied der mir sofort auffiel war, dass sich die Ärzte in den USA deutlich freundlicher um die Patienten kümmern. Bislang betrug meine längste Wartezeit im Wartezimmer 20 Minuten und einen Termin bekam ich innerhalb von drei Tagen. Notfalltermine sind kein Problem. Termine für MRT’s gibt es ruckzuck. Ein großer Nachteil des überdurchschnittlichen Services: den lässt man sich natürlich gut vergüten. In meiner Recherche vor meinem Umzug hatte ich mich ausgiebig über Kosten erkundigt und war nicht überrascht, als man mir sagte, man würde einen Ultraschall meiner Innereien mit ca. 1300 Dollar ansetzen. Meine Versicherung trägt einen großen Teil der Kosten, doch trotzdem bleiben 20 Prozent an mir hängen. Zwar nur bis zu einer gewissen Grenze, wird dieser erreicht übernimmt die Versicherung 100 Prozent, doch in dem Moment, in dem die erste Rechnung eintrudelt, schluckt man schwer. Obwohl ich dieses Geld als „du bist halt krank“-Geld vorab erspart hatte, kommt trotzdem die deutsche Patientin durch, die sich fragt, wer um alles in der Welt so gute Arbeit leistet, dass dieser Betrag gerechtfertigt wäre. Das war ziemlich genau 10-mal so viel wie ich bei meinem Frauenarzt für die selbe Untersuchung zahle. Nun stehen diesem Betrag allerdings eineinhalb Stunden Untersuchung gegenüber, wohingegen mein Frauenarzt keine fünf Minuten mit einem Ultraschall in mich hineinschaut. Ich bin mir selbst nicht schlüssig was mir besser gefällt, aber prinzipiell liegt die Priorität eher auf der Qualität. Hätte ich kein Ehlers-Danlos-Syndrom, sondern irgendeine der „normalen“, häufigen Krankheiten, wäre ich in San Francisco medizinische gesehen im Himmel auf Erden, denn mit UCSF und Stanford befinde ich mich zwischen zwei der großen Elite-Unis. EDS ist dort kein Fremdwort, aber wirklich umfangreich ist die Betreuung nicht.
Alle meine Ärzte sind zu jeder Zeit via E-Mail erreichbar. Ich kann in einer App und am Laptop Rezepte bestellen und kurze Videochats für einzelne Fragen anfangen. Das hatte ich in Deutschland nur vereinzelt. Meine Angst plötzlich komplett alleine dazustehen hat sich zum Glück nicht bestätigt. Forschung ist bei den Ärzten in San Francisco durch die großen und konkurrierenden Unis viel präsenter, sei es der Hausarzt oder ein Spezialist. Das kommt mir zugute. Bislang wurden meine eingereichten Paper ohne Augenverdrehen angenommen und mein aktives Selbstmanagement gern gesehen. Ich bin noch nicht auf Ablehnung gestoßen, weil ich Vorschläge zu meiner Behandlung gemacht habe oder gut informiert bin. Im Gegenteil, bisher wurde das sogar gelobt.
Ein großer Vorteil ist, dass ich in einer Großstadt wohne und sich dadurch, im Vergleich zu meiner deutschen Kleinstadt, die Wege zu meinen Ärzten verkürzt haben. Ich bin nicht mehr aufgrund des Mangels an öffentlichen Verkehrsmitteln darauf angewiesen überall hingefahren zu werden, sondern kann relativ selbständig zu meinen Ärzten gelangen. Der Ride-Sharing-Dienst Uber ist wohl mein größter Verbündeter. Für einen Bruchteil der Taxikosten kann ich mit einem Auto von A nach B gelangen. Auf der anderen Seite steht natürlich ein Kostenpunkt mehr auf der Liste, denn vorher fuhren mich meine Eltern zu allen Terminen. Jetzt bin ich auf mich alleine gestellt, was mir vor allem an schlechten Tagen etwas Angst einjagt. Die Transportkosten werden auch in der Zukunft nicht billiger, denn je weniger weit ich laufen kann, desto häufiger bin ich auf Fahrer angewiesen und das geht langfristig ins Geld. Selbst meine Physiotherapeutin ist so ungünstig gelegen auf einem Berg, dass ich trotz U-Bahn noch 30 Minuten laufen müsste. Nach einer ganzen Stunde hin und einer weiteren zurück, würde die Therapie am Ende nicht mehr viel zur Verbesserung meines Zustands beitragen. Außerdem gibt es in Kalifornien neue Möglichkeiten der Schmerztherapie, weil z. B. medizinisches Cannabis zugänglich und erschwinglich ist, was für viele EDS-Patienten ein Segen ist. Manche können sogar Opiate dadurch ersetzen und einer der EDS-Schmerztherapeuten Dr. Chopra meinte in seinen Vorträgen es wäre einen Versuch wert, denn die Erfolge von anderen EDS-Patienten versprächen Hoffnung. Es stimmt schon, dass sich immer wenn sich eine Tür schließt eine neue öffnet. Denn gerade als meine Schmerzintensität deutlich zunahm landete ich in San Francisco und hatte andere Möglichkeiten.
Doch die ganze Unsicherheit was nun von der Versicherung bezahlt wird und was nicht hat mich dazu bewegt meine arme Versicherung mit Anrufen zu überhäufen. Ich kann mir nicht erlauben auch nur eine dieser Untersuchungen komplett selbst zu bezahlen, weshalb ich ca. 300 Seiten Versicherungspolice gelesen und ganz in alter Karina-Manier sämtliche Unklarheiten notiert habe. Teilweise sogar schon bevor ich ausgewandert bin. Selbiges machte ich für viele andere organisatorische Dinge, denn auch Visum, Social Security Number und die vielen anderen nötigen Dokumente musste ich mir mühevoll zusammensuchen. Nein, in die USA einzuwandern wird einem nicht unbedingt geschenkt. Leider bin ich nicht die entspannteste Person wenn es um gravierende Zukunftsveränderungen geht, weshalb ich listenweise Fragen und Notizen zu allen Themen anfertigte. Listen zu schreiben und Fragen zu klären gibt mir ein subjektives Gefühl von Sicherheit und „alles im Griff haben“. Drei Jahre Planung und Überlegung, Kalkulation und Pro- und Kontra-Listen führten letztlich dazu dass ich mich traute nicht mehr länger zwischen zwei Ländern zu leben. Es war zu schwierig und schmerzhaft mich ständig umzugewöhnen, mich zu verabschieden und vor allem waren die körperlichen Anstrengungen des Flugs und des Jetlags auf Dauer nicht tragbar. Trotzdem war klar, dass ich erst dann in die USA gehen würde, wenn wirklich alles in Deutschland geklärt und abgeschlossen war. Ich wollte keine offenen Baustellen haben, die mich später einholen könnten. In jedem Fall musste ich das Gerichtsverfahren zwecks Rente abwarten und das dauerte über drei Jahre. Nachdem ich alle Kämpfe ausgetragen, alle Fragen geklärt und wir geheiratet hatten, stand dem Umzug eigentlich nichts mehr im Wege.
Finanziell können wir derzeit nur überleben, weil wir eine Wohnung fanden die deutlich weniger als Marktpreis kostet. Sollten wir jemals ausziehen müssen, wäre es das gewesen. Mit meinem kleinen Einkommen ist es unmöglich umzuziehen. Eine Zweizimmerwohnung? Zukunftsmusik. Derzeit leben wir in einer Einzimmerwohnung die vermutlich keinen deutschen Standard erfüllen würde. Ansprüche muss man zurückschrauben. Aber das ist ok. Dafür bin ich bei meinem Mann und habe das Privileg morgens auf das Meer blicken zu können. Das bedeutet mir mehr als irgendwelche Luxusgegenstände. Zumindest habe ich mittlerweile einen Topf und eine Pfanne, sechs Teller und einen Kleiderschrank aus Plastik für 10 Dollar. Leben mit einer chronischen Krankheit ist mit Opfern verbunden – das gilt ebenfalls für die USA und Deutschland.
Neben den medizinischen Kosten ist das Leben in San Francisco sehr teuer, was aber durch die vielen kostenlosen Angebote wieder ausgeglichen wird. Es gibt so viel Natur um mich herum, dass ich kein Geld für Kino oder andere Luxusdinge ausgeben muss. Ich kann mich einfach am Wochenende mit der U-Bahn zum Strand fahren lassen und Kraft tanken für 5 Dollar. Auf der anderen Seite gibt es gerade für angeschlagene Leute hilfreiche Angebote. Man kann sich praktisch alles bis vor die Haustür liefern lassen, sei es Lebensmittel oder ein Duschhocker. Meist gibt es irgendwo einen Gutschein der kostenlose Lieferung anbietet, was die Kosten damit gleichermaßen hoch sein lässt, als würde ich selbst in den Supermarkt gehen. Gerade der Lebensmittellieferant ist von großer Bedeutung, denn mit den ganzen Bergen und ohne ein Auto ist der Einkauf jede Woche eine große Herausforderung und alleine könnte ich den nicht managen. Wo in Neumarkt meine Mama alle Einkäufe, das Kochen, Putzen und Waschen übernommen hat, muss ich in San Francisco natürlich ganz anders mit meiner Energie haushalten, denn ich muss mich selbst um diese Dinge kümmern. Da passiert es schon mal, dass sechs Wochen nicht geputzt wird bis ich es einfach nicht mehr sehen kann, mich überlaste und damit für eine Woche komplett abschieße. Mein Mann unterstützt mich wo er kann, doch muss ich auch ein bisschen was für mich alleine schaffen. Ein anderer Vorteil in den USA ist dass die EDS Organisationen groß und aktiv sind und es unzählige Gruppierung gibt mit denen man sich nur unweit entfernt treffen kann. Und wieder: größeres Land – mehr Leute. Hätte man unbegrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung, was leider bei den meisten chronisch Kranken, inklusive mir, nie der Fall sein wird, wäre die Lebensqualität in dieser Stadt riesig. Aber wer braucht schon viel Luxus. Mental ist für mich gerade die umwerfende Natur und der Ozean ein großer Gewinn an Lebensqualität von dem ich in Deutschland nur hätte träumen können. Auch das Wetter, das konstant bei ca. 18 Grad liegt und sich selten verändert, ist sowohl für meinen Kreislauf als auch für meine Gelenke angenehm. Die Sommer und Winter in Deutschland waren kräftezehrend und haben mich häufig in die Horizontale befördert.
Die Kultur und die Menschen unterscheiden sich nicht groß von Deutschland, vor allem deshalb, weil sowieso an jeder Ecke jemand steht der irgendwie aus Deutschland kommt, jemanden kennt der in Deutschland lebt oder sonst wie deutsche Vorfahren hatte. Angenehm ist auch die Toleranz und Offenheit der Menschen in San Francisco. Es gibt eine riesige Gay Community und viele Menschenrechtler in dieser Ecke der USA. Vieles hier ist besser als in Deutschland, anderes schlechter. Das medizinische System, oder besser das soziale System, ist im Vergleich extrem schlechter, vor allem für chronisch Kranke die kein Geld haben. Menschen die gut versichert sind, genießen eine exzellente medizinische Versorgung an vielen hoch angesehenen Universitäten. Ich weiß ich bin privilegiert. Denn ich habe die Möglichkeit in zwei Ländern zu leben. Doch auch das hat zwei Seiten.
Wer denkt auszuwandern in die USA mit einer chronischen Krankheit wäre einfach, täuscht sich. Es ist jedoch auch nicht unmöglich. Mit guter Planung und viel Persistenz kommt man zurecht. Trotzdem muss jedem bewusst sein, dass man sich die doppelte Arbeit auflastet, denn Ärzte, Versicherungen, Kosten kommen immer Mal zwei – für Deutschland und die USA.
Alles hat Vor- und Nachteile und am Ende ist und bleibt man krank – egal wo auf der Welt, das ist nie ein Zuckerschlecken. Trotzdem bin ich froh den Mut aufgebracht zu haben diesen Schritt zu wagen und habe ihn bisher nicht bereut. Für mich ist die Welt ein Stückchen kleiner geworden und genieße die spannenden Einblicke in beide Länder. Was meine Halswirbelsäule angeht, hat sich für mich gar nichts verändert, meine allgemeine medizinische Versorgung hat sich verbessert – doch am Ende gleichen sich Vor- und Nachteile beider Länder relativ aus und es ist klar dass chronische Kranke in Deutschland als auch in den USA immer hart arbeiten müssen um die Hilfe zu bekommen, die sie verdienen.
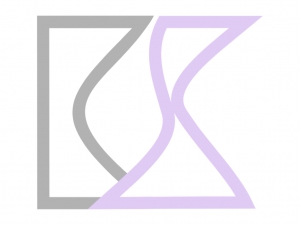



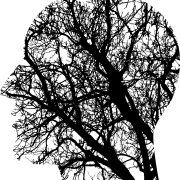



 Karina Sturm
Karina Sturm 

 Neumarkt TV
Neumarkt TV Karina Sturm
Karina Sturm
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!