Von einem Extrem ins andere – Wie es sich anfühlt, bipolar zu sein, Teil 1
In den folgenden zwei Beiträgen erzählt euch die Bloggerin Lisa Waldherr vom Beginn ihrer bipolaren Erkrankung und all den damit verbundenen Gefühlen. Teil 1 beschreibt Lisas Leben während der anhaltenden Hochphase vor dem ersten großen Tief.
Ich starre an die Decke.
Die Decke, die gar keine Decke ist, sondern der Lattenrost des Bettes über mir. Alte vergilbte Holzplanken und zwischen ihnen eine verwaschene Matratze, die definitiv schon bessere Zeiten gesehen hat. Wie die Matratze, auf der ich selbst bewegungslos und wie erstarrt liege, unter dem billigen Bettlaken aussieht, will ich gar nicht wissen.
Ich liege im Schlafraum eines Hostels.
In Singapur. Ich habe die Betten nicht gezählt, aber es dürften so um die 30 sein. Ich habe mein Handy schon lange nicht mehr gecheckt, deswegen weiß ich nicht, wie spät es ist. Dazu müsste ich mich bewegen und mit der Hand unter mein Kopfkissen greifen, wo ich das Handy am Abend zuvor versteckt habe, damit es nicht geklaut wird. Vielleicht ist es nachmittags.
Aus dem Fenster kann ich nicht schauen, da alle Vorhänge zugezogen sind.
Wahrscheinlich hat sich keiner der anderen Backpacker überhaupt erst die Mühe gemacht, sie aufzuziehen, weil sie direkt nach dem Aufstehen frühstücken gegangen sind. Und direkt nach dem Frühstück haben sie ihre Sachen gepackt, um die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erkunden, mit dem Boot zu fahren, einen Ausflug nach Sentosa Island zu machen oder sich mit dem ultraschnellen Aufzug auf die obere Plattform dieses riesigen Hotels zu beamen. Die sieht so aus, als würde ein Schiff auf drei Säulen liegen und ist so lang wie die Hotelkomplexe hoch. Mit Infinity Pool.
Ich bin alleine in dem großen kahlen Raum.
Ein seelenloser Raum, in dem lieblos ein paar Messingstockbetten aufgestellt wurden. Aber für den Preis pro Nacht darf man sich echt nicht beschweren. Allein meinen Augenlidern den Impuls zum Blinzeln zu geben, kostet mich fast unüberwindbare Kraft. Kraft, die still und heimlich aus meinem Körper und Geist gewichen ist, ohne auch nur einen winzig kleinen Rest übrig zu lassen. Wenigstens ein paar Krümel, an denen ich mich festklammern könnte. Etwas, das mir sagen könnte: “Es geht vorbei. Es wird schon wieder. Du schaffst das!“ Sie ist einfach gegangen, ohne mir die Möglichkeit zu geben, sie aufzuhalten. Ihr zu sagen, dass ich sie noch brauche. Sie ist weg. Als wäre sie niemals da gewesen.
Ich habe keinen Hunger.
Schon seit Tagen nicht mehr. Im Hostel gibt es jeden Tag weißes labberiges Toastbrot, Erdnussbutter und Marmelade umsonst im Frühstücksraum. Peanut butter jelly. All day long. Fand ich eigentlich immer geil. Vorgestern habe ich mich noch irgendwie hin geschleppt, um dann sofort wieder umzukehren, weil sich dort so viele Leute getummelt haben. Sich auf unterschiedlichsten Sprachen unterhalten haben. Alle gut gelaunt. Kommunikativ. Offen. Traveller’s high. War ich das nicht selbst noch vor gerade mal zwei Wochen? Konnte ich so etwas mal? Wo ist dieses Ich hin? Wo bin ich hin?
Es ist die letzte Etappe meiner Reise.
Die letzte Etappe der Reise, auf die ich so lange hingefiebert hatte und es gar nicht erwarten konnte, wegzukommen aus meinem alten Leben, der Schule und den Leuten dort, die mir nie wirklich lagen. Wegzukommen von dem Leistungsdruck, den ich mir selbst immer gemacht hatte – nur ich selbst und niemand anderes. Weg von den Regeln, die andere für einen machten. Ich hatte Freunde. Gute sogar. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass ich nicht auf denselben Bahnen schwamm wie sie. Nicht besser. Auch nicht schlechter. Einfach anders. Ich hatte damals das Gefühl, die meisten von ihnen waren zufrieden mit dem, was sie hatten. Mit dem, was war. Ich nicht.
Ich wollte mehr.
Ein Teil von mir wollte ausbrechen, frei sein, durchdrehen, endlich unvernünftig sein, Neues sehen, Altes hinter mir lassen. Neues erleben, Altes vergessen. Auf die Suche gehen, nach etwas, von dem ich noch nicht wusste, was es sein würde. Aber was ich wusste war, dass ich es finden würde. Und dass ich das nur könnte, wenn ich abhaute. Weit weg. Per Anhalter raus aus jeder erdenklichen Komfortzone.
Ich hatte lange das Gefühl, über viele, vielleicht sogar die meisten Dinge keinerlei Kontrolle zu haben.
Ich lebte nicht mein Leben, sondern auf eine gewisse Weise lebte es mich. Diesem Gefühl von Kontrollverlust und Machtlosigkeit habe ich vermutlich meine stets überdurchschnittlichen Leistungen zu verdanken. Und das nicht im positiven Sinne. Es war auch nicht so, als ob ich keine Menschen in meinem Leben gehabt hätte, die mich liebten. Die ich liebte. Ganz im Gegenteil. Dass ich keine schöne und behütete Kindheit oder Jugend gehabt hätte. Nein, auch das war es nicht. Manchmal quälte mich ein schlechtes Gewissen, weil ich mir so undankbar vorkam. Aber da war etwas in mir, das befreit werden wollte. So etwas wie ein „wahres Ich“, begraben unter vielen anderen Dingen, die es jahrelang stets in Schach gehalten hatten. Diese Dinge wollte ich wegschaufeln und schauen, was sich darunter verbarg. Ob da nicht noch mehr war.
Australien. Neuseeland. Bali. Fiji. Singapur.
So viele Sehnsuchtsorte, die ich in den letzten Monaten besucht hatte. So viele Eindrücke. Wunderschöne Erlebnisse. Unvergessliche Erfahrungen. Magische Momente. Außergewöhnliche Menschen. Inspirierende Gespräche. Bereichernde Begegnungen. Pulsierende Metropolen. Landschaften und Natur, die ich mir noch vor einem Jahr nicht einmal zu erträumen gewagt hätte. Jobs, von denen ich niemals gedacht hätte, dass ich sie einmal machen würde oder könnte. Das erste eigene Auto – ohne Versicherung. Freundschaften, von denen ich wusste, sie würden bleiben. Verliebtsein, von dem ich wusste, dass es nicht bleiben würde. Der Reiz, der genau darin lag. Das Gefühl von Unabhängigkeit, Freiheit und Selbstbestimmung, nach dem ich mich so lange gesehnt hatte. Mein Leben. Mein Ich. Meins. Alles. Glückseligkeit.
Bis vor wenigen Tagen war alles gut.
Noch vor zwei Wochen fuhr ich mit einem überdimensionalen Rasenmäher über die Farm im obersten Norden Australiens, wo ich einige Wochen lang arbeitete. Ein älteres, unfassbar herzliches Pärchen, Heather und Jerry, die ein Bed and Breakfast dort mitten im Nichts betrieben, die ich bei der täglichen Arbeit unterstützte. ‘Wwoofing’ hieß das. Das stand für „Willing workers on organic farms“. Eine gängige Art für Reisende, eine Zeit lang Geld zu sparen, indem sie ihre Arbeitskraft für Unterkunft und Essen zur Verfügung stellten, meistens auf einer Farm.
Ich stand jeden Morgen voller Euphorie mit dem Sonnenaufgang auf.
Dann schnitt ich Hecken, machte die Betten und putzte die Räume des Bed and Breakfast. Ich half Heather nachmittags auf der lichtüberfluteten Veranda des Farmhaupthauses beim Kumquat-Marmelade einkochen, bretterte lachend mit dem Rasenmäher über das riesige Farmgelände und ließ mich so durchschütteln, dass ich mich am nächsten Tag für das Tragen von zwei BHs übereinander entschied und allen Daheimgebliebenen davon erzählte, weil ich es so lustig fand. Eines Nachts bekam ich panische Angst, weil ich undefinierbare schlurfende Schritte auf dem Flur in Richtung meines Schlafzimmers hörte – in einer riesigen Hütte mitten im Busch, die ich ganz allein bewohnte – nur um irgendwann festzustellen, dass es sich nicht, wie befürchtet, um einen australischen Busch-Axtmörder, sondern ein kleines niedliches Wombat-Tierchen handelte, das auf dem Wellblechdach seine Runden drehte. Beim nächtlichen Gang zur Toilette entdeckte ich einen riesigen grünen Frosch im Klo, erschrak mich zu Tode und entschied mich spontan zum Freiluftpinkeln, obwohl ich mich dabei im dunklen Nichts mindestens genau so gruselte.
Noch vor zwei Wochen war ich glücklich.
Ich fuhr jeden Nachmittag nach der Arbeit mit dem Fahrrad durch das nahegelegene Naturschutzgebiet, in dem Jerry Wandertouren für Touristen anbot, verlor mich in der unendlichen Weite dieses faszinierenden Landes, von dem ich in der langen Zeit trotzdem nur einen so klitzekleinen Teil gesehen hatte, ignorierte die Verbotsschilder, fuhr weiter und sah hier und da kleine Krokodile und gar nicht mal so kleine Schlangen am Wegrand. Ich saß jeden Nachmittag zum Afternoon-Tea und jeden Abend zum Dinner mit Heather und Jerry zusammen und kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Über ihr Leben. Ihre Geschichten. Heather war Krankenschwester bei den Flying Doctors gewesen, hatte damals in New York ihre Ausbildung gemacht und in ein paar Jahrzehnten vermutlich mehr erlebt als andere Menschen in einem ganzen Leben.
Noch vor zwei Wochen fühlte ich mich frei.
Ich lief jeden Abend nach dem Essen mit meiner großen Taschenlampe den kleinen Trampelpfad durchs Stockfinstere zurück zu meiner Hütte, sah Schlangen, hoffte, dass es keine Brown Snake war, der ich versehentlich den Weg versperrte, sie somit in Bedrängnis brachte und zur Verteidigung provozierte. Machte meine Taschenlampe aus, sah nach oben in den abgefahrensten Sternenhimmel, den ich je in meinem Leben gesehen hatte. Stellte fest, wie unfassbar weit weg ich wirklich von zu Hause weg war. Denn der große Wagen und alle anderen Sternbilder standen Kopf. Weil ich auf der anderen Erdhalbkugel war. Ganz alleine. Und so unfassbar frei.
Zu Lisas Blog gehts hier:
https://tanzzwischendenpolen.com/
Bild: Gregor Runge
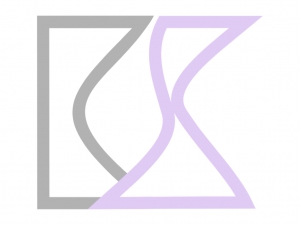

 Karina Sturm
Karina Sturm 









Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!